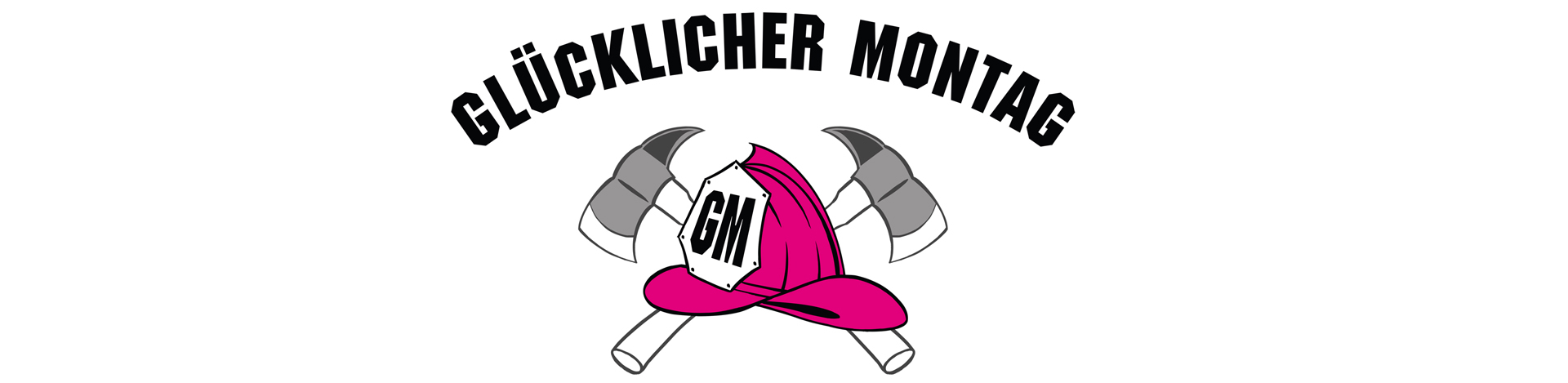„LEIPZIG VON OBEN“ INTERVIEW MIT SCHWARWEL NR. 2

Tränen, Trauer, Tod. Schmerz und Vergänglichkeit. Leben. Wie gehst du mit dem Sterben und dem Tod geliebter Lebewesen um? Kannst du aufgrund deines eigenes Erlebens und Empfindens anderen Menschen eine Empfehlung geben, wie sie sich selbst mit dem Tod, ihrem eigenen und dem anderer, auseinandersetzen können, um lernen damit umzugehen und es eben nicht zu unterdrücken und wegzuschieben, wie wir das alle vortrefflich zu beherrschen scheinen?
Schwarwel: Nach meiner Erfahrung ist aktives Teilhaben das einzige, was einem dabei hilft, mit Verlust und dem damit verbundenen Schmerz umgehen zu lernen. Wenn ich mich in mein Schneckenhaus aus Angst, Zweifel und Ohnmacht verkrieche, nährt das diese Ängste und Zweifel und die Ohnmacht nur umso mehr und ich fühle mich mehr und mehr einem nebulösen, es mit mir schlecht meinendem Schicksal ausgeliefert, das alles hinwegrafft, was eine Bedeutung für mich hat. Wenn ich das zulasse, hat der Tod schon gewonnen. Wir sind aber hier, um zu leben – tot werden wir dann nach unserer kurzen Existenz sowieso für alle Ewigkeiten sein, da kann ich die Zeit davor auch nutzen, um zu interagieren, um etwas zu bewegen, um mich zu bewegen: um am Leben mit den anderen teilzunehmen. Diese unaufhaltsame Vergänglichkeit allen Lebens inklusive aller Menschen, Tiere und Pflanzen, die ich kenne und liebe, versuche ich mir ständig bewusst zu halten, um die kurze Zeit auskosten zu können, die ich mit diesen Menschen, Tieren und Pflanzen verbringen kann. Das ist im Alltag und in unserem „normalen Leben“ natürlich schwer, weil man sich in dieser lauten Welt ständig hin- und hergeworfen fühlt und jeden Tag irgendetwas Neues die Sicht auf den Himmel zu versperren scheint. Aber ich glaube, genau darum geht es: Sterben und Tod sind ein natürlicher Prozess, der unserem Leben überhaupt erst einmal Wert verleiht. Da wäre es unsinnig und vollkommen nutzlos, sich abzuwenden.
Gibt es in Deutschland und international eine „würdige“ Sterbekultur? Was wünschst du dir, um eine intensivere Sterbebegleitung und Auseinandersetzung mit dem Sterben zu gewährleisten?
Schwarwel: Soweit ich das erlebe, ist gerade gesamtgesellschaftlich ein bewusstes Hin- bzw. Zurückwenden zu einer besseren Pflege- und Strebekultur im Gange. Kann auch sein, dass ich da in meiner eigenen Filterblase feststecke, weil wir uns auch als Studio Glücklicher Montag in den letzten Monaten und Jahren mehr und mehr selbst mit solchen Themen auseinandersetzen, doch ich glaube schon, dass die Wahrnehmung mich da nicht allzu sehr trügt. Nach so vielen Jahren exzessivem Kapitalismus mit diesem sinnlosen Streben nach möglichst vielen irdischen Gütern ist der Bogen ziemlich überspannt und verschiedene Gruppen der Gesellschaft suchen m. E. unabhängig voneinander nach anderen, neuen Wegen, Zufriedenheit, Sicherheit oder innere Ruhe für sich zu finden, da sich inzwischen wahrscheinlich herumgesprochen hat, dass man nichts von all dem, was wir anhäufen, mitnehmen kann. Da ist eine Rückbesinnung auf traditionelle Werte wie Familienzusammenhalt, würdevoller Umgang miteinander und Pflege der Bedürftigen doch gar nicht so schlecht. Wenn der Staat mehr Geld und Vertrauen in soziale Einrichtungen, heimische Pflege und besseren Ethikunterricht investieren würde statt den Sozialabbau voranzutreiben, könnte man auch angstfreiere und offenere Bürger „herstellen“, die ihre eigenen Eltern oder Großeltern nicht in Sterbeheime weit von sich weg abschieben oder abschieben müssen, sondern die sich kümmern und die es als Privileg empfinden, diese schweren Zeiten mit ihren Angehörigen verbringen zu dürfen. Ich empfinde das jedenfalls so. Aber daran müsste ein Staat natürlich auch spürbar interessiert sein und nichts stört die Ruhe im Karton mehr als ein mündiger Bürger, der seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Doch gerade dieser Sozialabbau führt meiner Meinung nach dazu, dass sich verschiedene Interessengruppen selbst organisieren und versuchen, die Defizite auszugleichen, die durch eine Fokussierung des Staates auf reine Wirtschaftlichkeit entstehen und entstanden sind. Was ich mir wünsche, wäre eine staatlich gestützte intensive Auseinandersetzung mit Krankheit und Leid, mit dem Sterben und Tod vom Kindesalter an, in der KiTa, in der Schule, beim Studium und in der Ausbildung – an meinen noch sehr jungen Enkelkindern sehe ich ja, wie natürlich und angstfrei sie mit solchen Themen umgehen, egal, ob sie mit meinem sterbenden Vater und dessen Leichnam zusammenkamen oder den Tod unserer Leguane begleitet haben, die sie vorher immer mit gefüttert und gepflegt haben. Da kann jeder Erwachsene noch viel lernen.
Sind deines Erachtens Krankheit – also physisch wie auch psychisch – und Tod Tabuthemen in unserer Welt und wenn ja, was könnten die Gründe dafür sein? Was kann jeder einzelne dafür tun, um dies zu verändern?
Schwarwel: Ja, Krankheit und Tod werden in unserer Gesellschaft oft und gern verdrängt, an den Rand und außerhalb unserer Sichtweite geschoben. Ist ja unangenehm, sich damit zu befassen. Dadurch entsteht der falsche Glaube, sowas passiert immer nur den anderen. Im Zuge der immer stärkeren Verstädterung während der Industriellen Revolution hat sich das verselbständigt. Wo vorher unter einem Dach geboren, gelebt und gestorben wurde, sind jetzt Krankenhäuser und Hospize irgendwo am Rande der Stadt und Seniorenwohnheime außerhalb der Wahrnehmung, wenn man auf dem Weg ins Büro ist. Ganz, ganz furchtbar. Staatlich gefördertes Wirtschaftswachstum wird über die Familie und soziale Themen gestellt. In so einem Klima rücken Krankheit und Tod natürlich irgendwo an den Wahrnehmungsrand und wir werden zu emotionalen Krüppeln, weil wir den normalen Umgang miteinander verlernen – wenn jemand ernsthaft erkrankt, wird er ins Krankenhaus gebracht, die kümmern sich dann schon. Alles ist auf die bestmögliche Funktionalität des Menschen eingerichtet – Depression heißt jetzt Burn-out, Krebskranke kommen sich wie Störenfriede vor, weil sie anderen zu Last fallen. Es war anfangs keine Absicht, diese Themen in unserem Film so prominent anzusprechen – das hat sich einfach durch die Art der Erzählung und durch die Darstellung so ergeben. Und durch die Aneinanderreihung verschiedener Situationen, in denen Krankheit, das Sterben und der Tod eine Rolle spielen, gewannen diese Themen an Kraft. Bspw. in Gesprächen mit Menschen aus der Palliativmedizin und mit Hospiz-Angestellten und -Ehrenamtlern auf der „Leben und Tod“-Messe in Bremen, wo wir unseren Film zeigten, kam immer wieder das Feedback, wie wichtig es ist, den natürlichen Prozess des Sterbens und die Vergänglichkeit wieder in den Fokus unseres Lebens zu bekommen. Die Auseinandersetzung mit unseren Kranken und Sterbenden ist neben der Last, die man sich aufbürdet, vor allem eine große Bereicherung fürs eigene Seelenleben. Mir ging und geht das jedenfalls so. Man bekommt im ungezwungen, offenen Umgang mit leidenden Familienmitgliedern oder Freunden auch sehr viel zurück. Das kannste mit Geld nicht kaufen.
„Dazu führt Patriotismus, dazu führen Hass und Angst: Alles geht in Flammen auf.“ Ein Zitat in eurem Film. Wut, Wutbürger, fehlende Bildung, PEGIDA und LEGIDA, Unterdrückung, Rassismus und Menschenfeindlichkeit … Wie setzt du dich mit diesen Themen auseinander – du bist ja nicht nur Regisseur und Trickfilmer, sondern auch Karikaturist und Mensch? Wie gehst du mit Ohnmacht um? An was „krankt“ unsere Gesellschaft? Was fehlt unserer Gesellschaft für ein besseres, menschliches, emphatisches Miteinander?
Schwarwel: Wie ich damit umgehe? Normal, hoffe ich. Sicher befasse ich mich als Karikaturist schon von Berufs wegen intensiver mit dem, was in unserer Gesellschaft so schief geht, aber zuerst war die Wahrnehmung meiner Umwelt, dann erst der Beruf des Karikaturisten. Eher als ein Weg für mich, mit der lähmenden Ohnmacht und solchen drängenden Themen klarzukommen und dabei nach kleinen, machbaren Alltagslösungen zu suchen. Innerhalb seines eigenen Wirkungskreises kann man ja viele Dinge ändern. Bspw. fehlende Bildung helfen wir als Glücklicher Montag mit unseren Workshops auszugleichen, wobei es uns nicht um das weitere Anhäufen von unnützem Wissen geht, sondern um die Herausbildung sozialer Kompetenz von Kindern und Jugendlichen. Rassismus und Menschenfeindlichkeit kann man m. E. nur sinnvoll bekämpfen, indem man die Leute in gemeinsamer Arbeit erleben lässt, dass man besser fährt, wenn man sich gemeinsam und schöpferisch mit Vorurteilen und Klischees auseinandersetzt statt permanent mit einer Hasskappe herumzurennen und alle anderen am Übel der Welt Schuld sein zu lassen. Wir merken immer wieder, dass da so ein 2- oder 3-Tages-Workshop echt Wunder bewirken kann. Obwohl wir formal natürlich nur Comics zeichnen oder Trickfilme machen, befassen sich die Teilnehmer mit „den großen Themen“, weil die als Inhalte der Arbeit dienen. Mit unserer Arbeit können wir an Schulen oder in Lernstuben mal den Alltagstrott aufbrechen und festgefahrene Verhaltensmuster oder Denkweisen direkt thematisieren, ohne sinnlose Standpauken zu halten, die meist nur das Gegenteil bewirken oder gar nicht mehr gehört werden. Wir regen zur Teambildung an und ich helfe den Teilnehmern ganz konkret durch ihre schöpferischen Krisenzeiten, wenn sie vor ihrem Blatt Papier sitzen und die Stirn blutet vom angestrengten, ungewohnten Denken und der Auseinandersetzung mit den Selbstzweifeln. Das ist teilweise echt anstrengend, macht aber wirklich Spaß. Sowohl den Teilnehmern als auch uns und mir. Das kann ein normaler Schultag in den allermeisten Fällen nicht leisten – da muss der Lernstoff durchgeschrubbt werden und alle sind irgendwie gehetzt und gestresst und vor allem sehr weit weg von sich selbst. Das ist idealer Nährboden für Unzufriedenheit und Vorurteile, leichte Beute für Menschenfänger. Bei Erwachsenen ist das viel schwieriger. Die meisten sind extrem festgefahren in ihren Mustern und staksen wie auf Autopilot durch die Welt. Die bekommt man oft nur in ganz kleinen Dosen zum Umdenken oder überhaupt zum Denken, da die Angst überwiegt, es könnte dann alles nur schlimmer werden statt besser. Auf diese Angst ziele ich mit meinen Karikaturen, denn wenn man die loslassen kann, hat man wieder die Hände frei für eigene Handlungen.
Du positionierst dich in und durch „Leipzig von oben“ auch politisch, ohne anderen deine eigene Meinung aufzudrücken oder aufdrücken zu wollen. Ist deines Erachtens jeder politisch oder sollte jeder seine Meinung haben, äußern und dazu stehen? Ist es nicht auch ein Risiko, sich klar und deutlich zu positionieren und seinen eigenen Weg zu gehen? Bspw. könnten dadurch Jobs wegfallen, mögliche Partner könnten sich abwenden …? Oder ist gerade die Positionierung der Weg?
Schwarwel: Eigene Meinung, naja … eher eine eigene Haltung. Zum Leben, zur Welt, zum Sein als solchem. Klingt sehr hochgestochen, aber das meint ja auch der Filmtitel mit dem „von oben“ – einfach mal den Kopf heben und gucken, wo man sich hier befindet, ob sich das alles dufte anfühlt und ob man das auch so will. Wenn nicht: Kann ichs ändern? Was daran kann ich ändern? Klar fühlt es sich sicherer an, wenn man mit dem Hintern an der Wand langsam vorwärts kriecht und sich schnell abducken kann, wenn Gefahr droht – aber ist das ein Leben, das ich mir für mich wünsche? Mit Sicherheit nicht. Als wir das Drehbuch für „Leipzig von oben“ fertig hatten, war uns schon klar, dass das auch ein weiterer Schritt hin zu einer klaren politischen Haltung nicht nur für mich, sondern auch für unser Studio Glücklicher Montag sein würde. Das große positive Feedback stärkt uns dabei den Rücken. Mit meinen Karikaturen drücke ich ja auch schon seit 2010 meine Sichtweise auf die Welt, die Politik und das allgemeine Menschsein aus. Da ist es nur folgerichtig, wenn man diesen Weg weiterverfolgt, auch wenns mal stürmt und schneit. Mich persönlich macht das sehr viel zufriedener als irgendwelche Flyer oder Visitenkarten für Dinge zu gestalten, die mir letztlich wurscht sind, weil sie mich nicht berühren oder weil sie nichts bewirken oder weil sie nur auf kurzfristige Gewinne abzielen. Das habe ich lange genug gemacht. Die Arbeit selbst macht Spaß, aber ich war zutiefst frustriert, weil die Ergebnisse einfach nur im Getöse verhallten und so sinnlos schienen. Dienstleistungsterror und viel Wind um nichts. Und ganz ehrlich: Mehr Geld hatte ich deswegen trotzdem nicht auf dem Konto. Dann schon lieber Dinge angehen, die mich ausfüllen, mit denen ich mich wohl fühle – das ging am Anfang nur zweigleisig, weil man natürlich gegen seine eigene allgegenwärtige Existenzangst angehen muss, aber mit den ersten verkauften Karikaturen und Illustrationen wuchs auch die Selbstsicherheit, dass man das auch auf so einem Weg schaffen kann, ohne zu verhungern. Flyer und Poster mache ich immer noch, aber eben nur die, zu denen ich einen emotionalen Bezug habe und die für Dinge werben, die über hohles Konsumieren hinausgehen. Dabei gucke ich auch, welche Firmen da ihr Logo druntersetzen, denn, ja, jeder ist politisch, jede Firma ist politisch, jedes Autohaus, jeder Fleischfabrikant und jeder Getränkehersteller. Wenn ich beim Illustrieren oder Gestalten von Werbemitteln nur dabei helfen soll, die Welt ein bisschen schlechter zu machen, lehne ich das Auftragsangebot dankend ab.
Erfordert es nicht Courage und die Akzeptanz seines eigenes Selbst, einen derart intensiven und autobiografischen Trickfilm zu machen? Du legst der Welt und dem Betrachter schon sehr offen deine Seele und dein Leben dar – Seelenstriptease galore. Würdest du dir wünschen, dass dies mehr Künstler machen, dass es mehr Bücher, Filme und Kunst in dieser Art gibt? Warum meinst du, machen das nicht so viele, scheuen sich davor? Wovor scheuen sie sich?
Schwarwel: Es ist fürchterlich anstrengend. Man glotzt ziemlich tief in die eigenen Abgründe und das ist höchst unangenehm, schmerzhaft. Die romantische Vorstellung, das eigene Selbst wäre ein edles, erhabenes Wesen und man will immer nur das Beste für alle, geht dabei komplett zu Bruch, denn wir sind nun mal Menschen und keine Götter. Auf einer Schulter sitzt ein Engel, auf der anderen ein Belzebub. Und wie das so ist, wenn man zu lange in den Abgrund schaut: Dann schaut der Abgrund auch in dich hinein. Wie das andere mit ihrer Kunst machen, müssen sie natürlich selbst wissen. Für mich jedenfalls hat künstlerische Auseinandersetzung mit dem Leben auch immer was damit zu tun, dass man sein Selbst einbringt und mal alles in die Waagschale wirft. Sowas wächst erst mit der Zeit und die Ventile müssen sich dabei auch langsam öffnen, weil dir sonst alles um die Ohren fliegt. Unsere … meine Trickfilme sind da sehr interessant. Der erste — „Schweinevogel“ – ist vollgepackt und wild und laut. Da musste erstmal alles irgendwie raus. Im zweiten, „Herr Alptraum“, der ja von Christian von Aster geschrieben und gesprochen wurde, habe ich mich auf die Darstellung konzentriert, auf das Fachliche, wie man Emotionen im Trickfilm auf möglichst einfache und einprägsame Weise vermitteln kann. Bei „Richard“ gings dann schon langsam ans Eingemachte: als zentrale Szenerie wählte ich den Tag, an dem er starb und seine Geschichte erzählte ich als Rückschau auf sei vollgepacktes Leben. Das geht natürlich nicht, wenn man sich nicht selbst voll darauf einlässt. In „1813“ wollte ich die persönlichen Schicksale einzelner Menschen, die von der Völkerschlacht erfasst wurden, in den Fokus bringen. Das Schreiben des Drehbuchs und das Storyboarding sitzen mir heute noch in den Knochen – damit tat ich mich wahnsinnig schwer, weil ich die Personen im Trickfilm so nah und real wie möglich an den Zuschauer bringen wollte. Und das geht natürlich nur, wenn ich sie zuerst an mich selbst heranlasse. Für alle im Film Handelnden hatte ich mir reale Vorbilder aus dieser Zeit aus Tagebüchern und historischen Schilderungen der Völkerschlacht gesucht, damit die Schicksale nicht hingehunzt und auswechselbar wirkten, sondern damit sie nachfühlbar rüberkommen. Das war schon sehr, sehr intensiv beim Machen. Darauf aufbauend kam dann „1989 – Unsere Heimat …“, wofür ich die Vitas von meiner Schwester und mir als Ausgangspunkt und für die Hauptcharaktere wählte. Damit kenne ich mich aus, da muss ich nichts an den Haaren Herbeigezogenes oder Unglaubhaftes erfinden, sondern ich brauchte „nur“ erzählen. Durch die zweite Ebene der kleinen Funny-Figuren konnte ich auch die Schrecken der Teilung und des Schießbefehls so darstellen, dass man als Zuschauer mit den Knuddelleuten mitfühlen kann. Bei Workshops zum Thema ist es immer ein großer Moment, die Reaktionen der Betrachter zu sehen, wenn plötzlich aus dem Nichts heraus dieser kleine, niedliche Republikflüchtling von einem Grenzsoldaten brutal und blutig niedergestreckt wird. Ab da sind die Leute knallwach und verfolgen die Geschichte bis zum Ende. Mir tut es jedes Mal aufs Neue leid um diesen kleinen Kerl, der sein ganzes Leben noch vor sich hatte. Und um den Grenzer, der jetzt ein Mörder ist. Folgerichtig konnte ich mit „Leipzig von oben“ noch einen Schritt weiter gehen und es fühlte und fühlt sich absolut richtig an, wie die Geschichte erzählt wird. Bei der Arbeit an diesem Film war mir wichtig, mich an den positiven Dingen zu orientieren und den Fokus immer auf den leisen Momenten zu lassen, wo Menschen gemeinsam in eine Richtung schauen. Andernfalls wäre ich in so einer autobiografischen Handlung ertrunken. Was ich damit sagen will: Allein bei unseren Trickfilmen hatte ich Jahre Zeit, um mich in der Art der Erzählung zu üben und darin, die eigenen Dämonen nur nach und nach ans Licht zu lassen. Bei meiner Graphic Novel „Seelenfresser“, an deren dritten Buch ich schon ziemlich lange nebenbei arbeite, merke ich auch immer wieder, wie ich Widerstände überwinden muss, um die Geschichte weiterzutreiben, weil ich mit den Figuren mitgehe und sehr viel eigenes hineingepackt habe, dessen Ausformulierung oftmals quälend ist. Der Leser soll dann sanft durch die Handlung gleiten können und von dem Entwicklungsprozess, der zur fertigen Seite führt, soll er gar nicht so viel mitbekommen. Da kann ich jeden Künstler verstehen, der sich davor scheut, die moosbewachsenen Steine in seinem Seelengarten hochzuheben, weil unter jedem irgendetwas lauern könnte. Für mich selbst lohnt sich diese Art der Herangehensweise und ich kann sie auch Jedem empfehlen. Mir verschafft so eine Arbeit mehr Klarheit und man gewinnt an Selbsterkenntnis und lernt, seine Selbstzweifel und die Ohnmacht zu meistern.
Wie fühlt es sich an, am Zeichentisch zu sitzen und beispielsweise Szenen zu zeichnen, in denen dein Hund Clooney gestorben ist oder du ‚mit dem Rucksack auf dem Rücken’ deine Familie Richtung Berlin verlässt, ohne zu wissen, was die Zukunft bringt und ob du je wiederkehrst? Wie konntest du das alles noch einmal durchleben, um es zeichnen zu können, und damit umgehen? Viele Menschen stellen sich nicht ihrer eigenen Kindheit, arbeiten Vergangenes nicht auf, weil ja auch nicht immer alles „schön“ war.
Schwarwel: Es hilft ungemein, die Handlungsträger in die dritte Person zu setzen. Nicht ich sehe beim Tierarzt meinem Hund beim Sterben zu und nicht ich verlasse mit meinem Rucksack mein elterliches Heim und meine Heimatstadt – das tut „der Autor“. Dieser Figur kann ich meine Worte in den Mund legen und diese Figur kann stellvertretend für mich all diese Dinge noch einmal tun, ohne dass ich den Faden verliere und mich als Erzähler in den Erinnerungen verliere. Bei der Regiearbeit im Team war ich permanent darum bemüht, nicht „meine Schwester“ zu sagen, sondern „die Schwester des Autors“. Dieser Abstand war für mich notwendig, um als Filmemacher eine Geschichte erzählen zu können, die dem Zuschauer ein Einsteigen in die Handlung ermöglicht. Alles andere wäre irgendwie zur weinerlichen Nabelschau verkommen und ich schätze, dabei wäre ein ganz, ganz fürchterlicher Film entstanden. Aber sobald ich das Drehbuch losgeschickt habe, ist es nicht mehr „meine Geschichte“, sondern es ist der Inhalt eines Filmes, den ein Trickfilmstudio gemeinsam mit Filmförderern und TV-Partnern macht. Da gibt es ein Team, das sich um die diversen Belange kümmert – Animation, Koloration, Vertonung, Musik, Schnitt … Dieser Verantwortung gegenüber der Produktion bin ich mir da ständig bewusst und die will und darf ich auch nicht aus dem Auge verlieren, damit es ein guter Film wird, der auch andere berühren soll. Als ich in meiner stillen Ecke an den einzelnen Szenen gesessen habe, um die Key-Animationen oder die Backgrounds zu machen, war es absolut notwendig, sich auf die Handlung einzulassen, um die Bilder so emotional wie möglich umzusetzen. Da bin ich sehr tief eingetaucht und ich habe oft unter Tränen weitergezeichnet. Das war oft eine Herausforderung: sich wieder rausziehen und seine Regiearbeit gut zu machen. Aber auch da halfen jahrelange Routine und Übung beim Filmemachen. Eine professionelle Herangehensweise ist da extrem wichtig, um die einzelnen Aspekte so eines Projektes geordnet zu halten. Mir war bei „Leipzig von oben“ ständig bewusst, dass ich gerade Trauerarbeit leiste und mir hat das Machen des Filmes sehr dabei geholfen, mein Oberstübchen aufzuräumen. Ganz allgemein denke ich, dass kreative, künstlerische Tätigkeiten auf jeden Fall dabei helfen, besser mit dem Leben und sich selbst klarzukommen. Das können auch kleine Skizzenbücher sein oder Gedichte, Tagebuchschreiben … Eigentlich alles, was dabei hilft, sich selbst seine Erlebnisse aus einer anderen Perspektive vor die Nase zu halten.
Du scheinst ein Mensch zu sein, der ziemlich offen mit seinen eigenen Fehlern und Schwächen umgeht, vorausgesetzt man kann und darf dies überhaupt so bezeichnen. In anderen Interviews hast du dich z. B. dazu geäußert, dass du trockener Alkoholiker bist und unter einer klinischen Depression leidest. Gibt es etwas, vor dem du Angst hast? Etwas, das du noch nicht verarbeitet hast und so nicht offen und ehrlich darlegen würdest?
Schwarwel: Als trockener Alkoholiker bin ich natürlich immer auf der Hut vor einem Rückfall und als klinisch Depressiver treibt mich die Sorge um ein Abrutschen in die Kellergewölbe meiner Seele. Das gibt mir aber vor allem Antrieb und hält mich wach. Existenzängste bedrohen mich jederzeit – die Kunst besteht für mich eher darin, sie zu erkennen und früh genug gegenzusteuern oder auf ein anderes Gleis zu wechseln. Generell habe ich nach zwei Jahrzehnten angstvollem Haderns und damit einhergehender Aggressionen gegen mich und mein Umfeld dank psychologischer Hilfe irgendwann für mich erkannt, dass es nichts bringt, meinen Ängsten auszuweichen und Ruhe dadurch zu finden, dass ich mir mit Alkohol die Kante gebe. Das minderte meine Lebensqualität und die Lebensqualität meiner Umwelt enorm, ums mal höflich auszudrücken. Wenn man einmal die Katze aus dem Sack gelassen hat und sagen kann: Ja, ich bin Alkoholiker, ja, ich bin seit 2002 trocken, ja, es ist jeden Tag schwer, aber scheiß drauf, ich ziehe es trotzdem durch – das hebt das eigene Energielevel und den Willen, was Vorwärtsgerichtetes zu unternehmen. Das Gleiche gilt für die Depression – ich bin ja nicht die Depression, ich hab nur eine. Die hab ich bis ans Ende meiner Tage und es ist ziemlich sinnvoll, wenn ich lerne, mit ihr umzugehen, bevor sie mich auffrisst. Ein wildes Tier an meiner Seite, das sich niemals vollends zähmen lässt. Wenn man sich erst mal durchgerungen hat und soweit gekommen ist, fällt der Rest viel leichter. Aber ich habe ewig gebraucht und ziemlichen Flurschaden angerichtet, bis ich an diesem Punkt angelangt war. Und ich habe professionelle Hilfe in Anspruch genommen. Dadurch kenne ich die vermeintlich und tatsächliche Stigmatisierung durch die Gesellschaft und wie man sich dabei fühlt. Ist nicht schön, kann man aber ändern, indem man was tut. Einmal mehr aufstehen als hinfallen eben. Und die Ängste – die lauern immer. Wir sind alle so vollgestopft mit Angst. Sich ihr zu ergeben fällt durch die gewohnten und gelernten Muster viel leichter als sie durchzulassen und sie vorüberziehen zu sehen. Für mich sehe ich das als eine meiner Lebensaufgaben an, meinen allseits gegenwärtigen, knallwachen Feinden Angst, Macht, Wissen, Krankheit und Tod nicht auf den Leim zu gehen, sondern nach Wegen zu suchen, sie auszupendeln und vorwärts zu gehen.
Was sind die extremen und anstrengenden Momente während einer Trickfilm-Produktion? Wie gehst du mit Produktionsstress- und Druck-Situationen um? Und beispielsweise auch damit, dass sich die Produktionszeit bei „Leipzig von oben“ um über vier Monate verlängert hat?
Schwarwel: Das ist Druck, den man einfach aushalten muss. Der gehört bei so einer Arbeit immer dazu. Erst wenn man etwas erreichen will, merkt man die Widerstände, die sich auftun – in einem selbst und in der Gegend, wo man tätig ist. Da hilft eigentlich nur ein übermenschliches Maß an Geduld, die ich nicht immer aufbringen kann. Inzwischen habe ich jedoch gelernt, halbwegs damit umzugehen und in Krisenzeiten aufgrund des Zeit- und Gelddrucks die Kommunikation im Trickfilm-Team nicht abreißen zu lassen, weil man sonst keinen fertigen Film bekommt und alle bisher geleistete Anstrengung umsonst gewesen wäre. Eine Verzögerung von vier Monaten wie jetzt ist dabei schon bitter, wenn das Budget nicht darauf ausgelegt ist. Das kann man nur mit mehr Nachtschichten ausgleichen. Und unbedingt mit den Geschäftspartnern reden. Die Alternative wäre eine deutliche Kürzung der Handlung gewesen, aber nach intensiver Beschäftigung damit war klar, dass das einfach kein guter Film mehr geworden wäre. Also Zähne zusammenbeißen und durch. Gegen den Druck bei so einer Produktion hilft mir der relativ lange Fußweg ins Studio und zurück. Da muss ich mich auf meine Rabaukenhunde konzentrieren und echtes Wetter und echte Leute sind ringsum, das hält mich in der Gegenwart.
Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit dem GewandhausKinderchor und wie verlief diese?
Schwarwel: Meine Tochter hat in ihrer Schulzeit auch schon jahrelang in diesem Chor gesungen, weshalb ich schon seit Jahrzenten DieHard-Fan des GewandhausKinderchores bin, und ihr letzter Chorleiter war der auch jetzt amtierende Frank-Steffen Elster, den ich dadurch als Elternteil kannte, wenn wir zu Chorfesten Nudelsalate und Kuchen mitbrachten oder die Kinder zum Chorlager ablieferten. Während der Vorproduktion von „Leipzig von oben“ trafen wir uns zufällig im Baumarkt und ich fragte spontan, ob es möglich sei, relativ kurzfristig mit dem GewandhausKinderchor zusammenzuarbeiten. Frank-Steffen bejahte und wir machten in der Folgewoche ein Treffen aus. Da wir als Soundtrack bereits Leipzig-affin ein Mendelssohn-Stück in einer Interpretation vom Gewandhausorchester unter Kurt Masur lizensiert hatten, wollte ich auch den GewandhausKinderchor dabei haben, da der Chor selbst mit Beethovens „Ode an die Freude“ eine handlungstragende Rolle spielt. Die Konditionen waren wirklich sehr unkompliziert und in Kürze ausgehandelt und ein Termin schnell gefunden, da die Aufnahmen für das Stück in einer regulären Chorprobe zu bewältigen waren, nachdem Frank-Steffen die Proben für das Stück mit ins Probenrepertoire des alljährlichen Chorlagers aufgenommen hatte. Als es im Herbst 2015 soweit war, rückten wir zu viert im Gewandhaus ein: unsere Produzentin Sandra, unser Sounddesigner Alexander Oeconomo und dessen langjähriger Bekannter Klaus Mücke, der bereits seit gefühlten hundert Jahren Aufnahmeleiter für MDR-Mitschnitte des Gewandhausorchesters war und auch den Klang des Mendelssohn-Saales kannte, sowie ich als Regisseur. Für die Aufnahmen hatte Frank-Steffen 34 Mitglieder des Chores ausgesucht, die das Stück aus dem Effeff beherrschten und mit deren Stimmmischung das Lied sehr ausgewogen klingen würde. Binnen einer Stunde waren wir mit allem durch und es ist eine Stunde geworden, die ich nie vergessen werde, weil das wie ein Privatkonzert mit einem meiner Lieblingslieder war, sehr berührend, sehr schön. Der Saal total leer, nur der Chor und wir. Gänsehaut. Frank-Steffen hatte eine fünfstrophige Variante der „Ode an die Freude“ für einen kleinen Chor arrangiert, aus dem Klaus Mücke eine drei- und eine fünfstrophige Variante schnitt und jeweils drei Soundvarianten anbot: trocken, kleiner Hall und großer Hall. Letztlich haben wir alles im Film verwenden können und für den – für den Film und den Zuschauer sehr wichtigen – Abspann den trockenen Sound genommen, weil der am persönlichsten ist und man das Gefühl hat, der Chor steht direkt um dich herum. Bei der Premiere im Zeitgeschichtlichen Forum brachten Frank-Steffen und neun Chormitglieder den Saal zum Schluchzen und Seufzen, als sie da beim Filmgespräch mal eben aus der Kalten ihr Können unter Beweis stellten. Wahnsinn.
Eure Filme sind einige der wenigen Animationsfilme, die noch ganz klassisch 2D handgezeichnet sind mit aufwendig gezeichneten realistischen Figuren und Backgrounds. Was ist für dich das Besondere an dieser Art der Animation?
Schwarwel: Handgezeichnete 2D-Animation mit Bleistift auf Papier ist einfach durch nichts zu ersetzen. Es erfordert sehr viel Geduld, sehr viel Gefummel und sehr viele Radiergummies, aber der Effekt, den man durch solche handgezeichneten Bewegungen erzielen kann, ist mit nichts vergleichbar und auch auf keine andere Produktionsart zu erreichen. Es gab viele Szenen im Film, in denen man auch eine Abkürzung hätte nehmen können, indem man bestimmte Elemente einfach „aus dem Bild zieht“, aber letztlich habe ich mich dann immer dafür entschieden, auch solche Sachen mit mehreren Einzelzeichnungen umzusetzen, weil man den Unterschied eben doch sehen und spüren kann. Alles sieht etwas griffiger aus, nicht so rundgelutscht wie computergestützte oder computergenerierte Zwischenphasen. Der ganze Film sollte ja gezeichnet aussehen, da es auch im Inhalt um Handwerk geht, ums Machen. Das sollte sich auch im Stil und im Look widerspiegeln. Als klar war, dass der Film mehr als doppelt so lang wird als ursprünglich angedacht, habe ich natürlich erst mal geschluckt und klammheimlich grob überschlagen, was das für die Handzeichnungen bedeutet, doch da ich schon seit Jahren die Storyboards so zeichne, dass sie direkt als Layouts und Animationsvorlagen weiterverwendet werden können, war der Mehraufwand überschaubar. Im Vergeblich heißt das, dass wir für „Schweinevogel – Es lebe der Fortschritt!“, der genau wie „Leipzig von oben“ 23 Minuten lang ist, 20.000 Vorzeichnungen und 20.000 Reinzeichnungen angefertigt haben, für Leipzig von oben jedoch nur 10.000 Reinzeichnungen – und nur einen kleinen Stapel Vorzeichnungen, vielleicht maximal 500 Blatt. Zum einen liegt das natürlich daran, dass Schweinevogel unglaublich viele lippensynchrone Szenen hatte und jede Menge Münder und Gesichtspartien gezeichnet werden mussten, aber zum anderen haben wir seit 2008/2009 auch viel dazugelernt und ich kann inzwischen viele handgezeichnete Animationen verkürzt darstellen, ohne dass es für den Betrachter einen Unterschied gibt. Und das ist für mich als Art Director und Regisseur natürlich das Hauptkriterium: Der Betrachter soll unsere ganze Arbeit sehen und genießen und er soll vom Anfang einer Szene bis zu ihrem Ende an die Illusion der Bewegung glauben, die wir durch viele Einzelzeichnungen erzeugen. Bei „Leipzig von oben“ war es eine besondere Herausforderung, dass ich alles in einer traumhaften Verlangsamung zeigen wollte, um immer daran zu erinnern, dass der Autor gerade in der Küche seiner Eltern sitzt und wir meistens Zeuge seiner dahintreibenden Gedankenwelt sind. So wurde aus einer fliegenden Brottasche mal mit einer 9-Phasen-Animation – also 9 Zeichnungen – schnell ein Stapel von 65 Zeichnungen. Und das für so ziemlich jede Szene. Allein für den 4-minütigen Abspann mit den einzeln animierten Laubblättern zeichneten wir 2 verschiedene Blätter mit jeweils 32 Einzelphasen, die unser Animator Dirk dann in unendlicher Kleinarbeit in ToonBoom „übers Bild“ wandern ließ, nachdem wir aus allem noch drei verschiedene Größen für die Raumtiefe und verschiedenen Farbenvarianten für die Unterschiedlichkeit der endgültigen Blattmasse generiert haben. Das Ergebnis ist aber so schön geworden, dass sich dafür jeder Aufwand gelohnt hat. Ich könnte mir das ewig anschauen. Bei den Backgrounds bin ich teilweise ziemlich verzweifelt, da die Geschichte so viele Orte zeigt und so viele verschiedenen Stimmungen und Wettervarianten beinhaltet. Das war ein echtes Eigentor und allein der Rechercheaufwand war schon immens. Das Zeichnen selbst hat trotz des enormen Zeitdrucks irre Spaß gemacht, aber es war auch eine knifflige Heidenarbeit, die ganzen Bildebenen, die ja einzeln gezeichnet werden müssen, zusammenzubekommen, damit die Perspektiven stimmen und einzelne Bildelemente nachher unkompliziert unscharf gemacht werden können. Daneben muss auch jedes einzelne Efeublatt ordentlich mit geschlossener Linie gezeichnet werden, damit es nachher im Computer ohne Korrekturen auch einzeln eingefärbt werden kann. Auch hier hielten wir uns immer daran fest, dass das Ergebnis nachher den ganzen Aufwand rechtfertigen würde – und was soll ich sagen: Ich finde, es hat sich gelohnt.
Leipzig, Völkerschlachtdenkmal, Krieg, Revolution, Schweinevogel, SEELENFRESSER, das Leben der Menschen untereinander … all dies sind Themen deiner Trickfilme und eure Glücklicher Montag-Eigenproduktion sind miteinander verwoben und ergänzen einander. Warum entscheidest du dich für diese Themen? Gibt es eine inhaltliche Klammer zwischen deinem ersten eigenen Film „Schweinevogel – Es lebe der Fortschritt!“ und „Leipzig von oben“?
Schwarwel: Die Themen haben sich über die Jahre und unsere Interessenlagen einfach so ergeben, irgendwie kam eins zum anderen und es fühlte sich bisher immer natürlich an, wie die einzelnen Filme auf irgendeiner Metaebene aufeinander Bezug nehmen, wobei sie alle als Einzelwerke angelegt sind. Für unser 90-minütiges Programm „Total Eclipse of the Heart – Trickfilm-Shorts von Schwarwel“ haben wir die Filme jetzt erstmals inhaltlich zusammengeführt, so dass man sich endlich mal alles als Ganzes anschauen und selbst entscheiden kann, ob und wie viel das alles miteinander zu tun hat. Kann ja auch sein, die Verbindung ist nur in meinem Kopf und alle anderen sehen das nicht so … Naja, ich glaube schon, dass man das sieht, denn als Hobby habe ich bei allen Filmen und Dingen, die ich sonst so tue, immer das Bestreben, Übergange und Türen in die anderen unserer Werke einzubauen, um ein inneres Universum zur Orientierung zu haben, in dem sich das alles abspielen kann. Das erleichtert das Schreiben und die Umsetzung der einzelnen Sachen, da ich dann immer das Gefühl habe, schon mal da gewesen zu sein und nicht alles neu erfinden zu müssen. Ist wie alles im Leben natürlich nur eine nützliche Illusion und am Ende sitze ich doch wieder mit rauchendem Kopf da und zeichne Sachen, die ich noch nie im Leben gezeichnet habe und von denen ich noch nicht mal im Traum dachte, das ich sie je zeichnen würde …
Wie sind nach einer überaus erfolgreichen Premiere und bereits stattgefundenen Filmvorführungen die Reaktionen der Zuschauer auf „Leipzig von oben“?
Schwarwel: Die Reaktionen sind durchweg positiv und meistens sehr viel emotionaler, als man das sonst so gewohnt ist. Es gibt bei den Aufführungen, wo wir anwesend sind, viel mehr und viel intensivere Gespräche. Die Leute öffnen sich, weil der Film und wir so offen mit vielen tabuisierten Themen umgehen. Offensichtlich haben wir einen Nerv getroffen und intuitiv das Richtige in der richtigen Tonlage und der richtigen Geschwindigkeit erzählt. Ob das wirklich so hinhaut, sieht man selbst ja auch immer erst, wenn die fertigen Szenen nach und nach die abgefilmten Storyboards auffüllen und der Film Stück für Stück in der Realität erscheint. Doch wir und ich haben uns immer nur stoisch an das Drehbuch und die Storyboards gehalten – das ist immer ein guter Weg, um in die Nähe des Ergebnisses zu kommen, das man zu Beginn im Kopf hat: keine Experimente an der falschen Stelle und die Selbstzweifel hartnäckig ignorieren.
Euer Film ist jetzt fertig. Was sind die nächsten Schritte? Wie wertet ihr „Leipzig von oben“ aus?
Schwarwel: Wir sind schon mitten in der Auswertung. Die DVD-Rohlinge waren noch heiß, als wir sie bereits bei den ersten Workshops eingesetzt haben. Daneben lief „Leipzig von oben“ schon auf dem Filmfest Dresden und dem Neiße Filmfestival und weitere Festivals sind gerade in Vorbereitung. Das Schwarwel-Gesamtprogramm „Total Eclipse of the Heart“, in dem ja auch „Leipzig von oben“ enthalten ist, ist jetzt fertig und läuft im Leipziger Luru-Kino und als offizieller Prorammpunkt auf dem Comic-Salon Erlangen. Was damit noch möglich sein wird, finden wir gerade heraus. Daneben gab es bereits Vorführungen im Rahmen der „Leben und Tod“-Messe in Bremen und zum Wave Gotik Treffen beim VEID e. V., demnächst läuft der Film bei der Malefiz-Party der Funus-Stiftung, die sich um Bestattungskultur bemüht undsoweiter. Einige Workshops haben sich bereits in unserer täglichen Arbeit ergeben, daneben akquirieren wir auch aktiv neue Schulen und Projekte, da uns gerade die Arbeit mit Schülern und Kindern und im Bildungsbereich extrem wichtig ist und sie uns auch viel zurück gibt. Als Zweitauswertung arbeiten wir an einer Umsetzung als Graphic Novel, die auch einen Erklärbär-Anteil enthalten wird – mit unserem „1989 – Unsere Heimat …“-Film und dem dazugehörigen Buch haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, darauf bauen wir auf.
„Mein Leipzig lob ich mir“. Was ist für dich das Besondere an deiner Heimatstadt Leipzig, was macht Leipzig für dich aus?
Schwarwel: In Leipzig bin ich geboren, hier lebe ich, hier arbeite ich. Hier kenne ich mich aus und hier mische ich mich auch irgendwie ein … Wenn Heimat der Ort ist, wo man sich zu Hause fühlt, dann muss das für mich wohl Leipzig sein. Gerade Probstheida, Stötteritz, Connewitz und die Südvorstadt mit Abstechern in die Innenstadt sind für mich die Bezugspunkte, weil ich hier am meisten hin- und herwedele. In unserem Film „Leipzig von oben“ ist ein kurzer Abriss all der Sachen vorhanden, die mir bei Nennung des Wortes „Leipzig“ sofort gegenwärtig sind – um alles unterzubringen, müsste ich eine abendfüllende Film-Trilogie abliefern, aber ich denke, das geht jedem so, wenn er darüber nachdenkt, warum er gerade hier wohnt und lebt und nicht woanders. Da gehts um Detailfragen, um die Sprache und den Umgang miteinander, das gewisse Selbstverständnis und natürlich auch um gelebte Geschichte wie eben bspw. ein GewandhausKinderchor, den man aus dem Fernsehen kennt, zu dem man aber auch eine ganz eigene und persönliche Beziehung hat … Mit dem Hypezig aus der Journaille und mit Festakten zu Jubeljahren hat das alles herzlich wenig zu tun, ich mags eher erdiger und konkreter. Ich glaube, das ist auch die Essenz von dem, was Leipzig für mich ausmacht: Ich kann mittendrin sein.
Warum der Titel „Leipzig von oben“?
Schwarwel: In der Vorproduktion hatten wir den Titel als Scherz gehandelt, da ein Freund von uns an diesen „… von oben“-Dokumentationen arbeiten und unser Film ja auch eine Draufsicht auf Leipzig ist, nur eben ohne Drohne und nur vom Hügel der Etzoldschen Sandgrube aus. Irgendwie blieb der Titel aber hängen, weil er stimmig und sinnvoll war und ist. Vereinzelt gibt es zwar mal die Frage, wo denn der Hubschrauberüberflug im Film zu sehen sei, aber der überwiegenden Mehrheit der Zuschauer muss man den Filmtitel wirklich nicht erklären. Aber hey, wenn man dadurch ins Gespräch kommt, solls mir auch Recht sein!
Lieben Dank.
Danke, Schw